Kometen -im Deutschen oft auch Schweifsterne genannt- sind spektakuläre Erscheinungen am Nachthimmel und ein Fenster in die Vergangenheit unseres Planetensystems. Seit Jahrtausenden faszinieren sie und haben in Wissenschaft und Mythologie ihren festen Platz. Doch was steckt wirklich hinter den „Schweifsternen“? galaxie.digital nimmt dich mit in die Welt der Kometen, erklärt die Entstehung, ihre Typen und stellt berühmte Himmelsbesucher und Weltraummissionen vor. Zum Abschluss gibt es praxisnahe Beobachtungs- und Fototipps für neugierige Hobbyastronomen.
1. Was sind Kometen und wie entstehen sie?
Kometen sind Himmelskörper, die größtenteils aus Eis, Staub und Gesteinsbrocken bestehen. Man spricht oft von „dreckigen Schneebällen“, weil sie eine Mischung aus eingefrorenem Wasser, gefrorenen Gasen (wie Kohlendioxid, Methan, Ammoniak), organischen Molekülen und Staubpartikeln enthalten. Ihr Durchmesser reicht meist von wenigen hundert Metern bis einigen Dutzend Kilometern.
Ursprünge und Entstehung
Die meisten Kometen entstanden vor rund 4,6 Milliarden Jahren, als sich das Sonnensystem formierte. Sie sind Überreste der sogenannten planetaren Akkretionsscheibe und stammen aus entfernten Regionen, in denen sich die Bedingungen für die Bildung von größeren Planeten nicht günstig entwickelten. Diese Ursprungsgebiete sind:
- Kuipergürtel: Diese Region befindet sich jenseits der Neptunbahn (ca. 30–55 astronomische Einheiten von der Sonne). Viele kurzperiodische Kometen stammen von dort.
- Oortsche Wolke: Eine hypothetische, kugelförmige Wolke weit außerhalb des Sonnensystems (bis zu 100.000 AE entfernt). Sie gilt als Ursprung der langperiodischen Kometen.
Wenn Kometen durch gravitative Störungen (etwa durch vorbeifliegende Sterne oder die Planeten unseres Sonnensystems) in Richtung Sonne gelenkt werden, beginnt ihr spektakulärer Auftritt. Beim Näherkommen an die Sonne „verdampft“ ein Teil der Eiskomponenten, es entstehen Gase und eine Hülle aus Staub und Plasma – die sogenannte Koma. Sonnenlicht und Sonnenwind sorgen dafür, dass Kometen ihre charakteristischen Schweife entwickeln.
2. Welche Arten von Kometen gibt es?
Astrophysiker unterscheiden Kometen vor allem nach ihrer Umlaufzeit:
- Kurzperiodische Kometen: Diese haben eine Umlaufzeit um die Sonne von unter 200 Jahren. Sie wechseln relativ häufig zwischen Sonne und den äußeren Bereichen des Sonnensystems. Bekannteste Vertreter: Komet Halley, Komet 67P/Churyumov-Gerasimenko. Sie stammen meist aus dem Kuipergürtel.
- Langperiodische Kometen: Ihre Umlaufzeiten betragen oft Tausende oder gar Millionen Jahre. Sie kommen aus der Oortschen Wolke und erscheinen meist nur einmal innerhalb eines Menschenlebens. Beispiele sind der Große Komet von 1680 oder Komet Hale-Bopp.
- Nicht-periodische Kometen: Manche Kometen besitzen eine hyperbolische Bahn – sie kommen einmalig ins innere Sonnensystem und verschwinden dann für immer in den interstellaren Raum.
3. Die fünf bekanntesten historischen Kometen
Im Laufe der Geschichte sorgten bestimmte Kometen für besonders viel Aufsehen – nicht nur wegen ihrer Schönheit, sondern auch wegen ihrer wissenschaftlichen Bedeutung und kulturellen Wirkung.
3.1 Komet Halley
Kein anderer Komet ist besser erforscht und beobachten als Komet Halley (offiziell: 1P/Halley). Er taucht alle 75–76 Jahre am Himmel auf und wurde schon seit der Antike dokumentiert. Seine letzte Annäherung an die Sonne fand 1986 statt; die nächste ist für 2061 angekündigt. Der schweifreiche Halley ist Namensgeber für Halley-artige Kometen und bekannt für spektakuläre Meteorströme – z.B. die Eta-Aquariiden und die Orioniden.

3.2 Komet Hale-Bopp
Der Komet Hale-Bopp (C/1995 O1) begeisterte im Jahr 1997 Millionen Menschen weltweit. Er erreichte eine scheinbare Helligkeit von 0 mag und war selbst in urbanen Gebieten zu sehen. Mit einem Kern von ca. 40 km Durchmesser zählt er zu den größten bekannten Kometen des 20. Jahrhunderts.
3.3 Komet Hyakutake
1996 besuchte der Komet Hyakutake (C/1996 B2) die Sonne und war ebenfalls mit bloßem Auge sichtbar. Besonders beeindruckend war sein langgezogener, bläulicher Plasmaschweif, der sich über viele Grad am Himmel erstreckte.
3.4 Großer Komet von 1680
Der Große Komet von 1680 (C/1680 V1) ist historisch wichtig, denn Isaac Newton nutzte ihn zur Entwicklung seiner Gravitationsgesetze. Selbst bei Tageslicht war er in Europa sichtbar und wurde Vorbild für die systematische Himmelsbeobachtung.
3.5 Komet NEOWISE (C/2020 F3)
Der jüngste Mega-Komet für Hobbyastronomen war NEOWISE im Sommer 2020. Mit einer Helligkeit bis 1 mag, deutlich sichtbarem Schweif und goldener Farbe wurde er als „Fotokomet für das Smartphone-Zeitalter“ populär.
4. Überblick: Bekannte Weltraummissionen zu Kometen
Kometen interessieren die Wissenschaft schon lange – sie gelten als kosmische Zeitkapseln voller uralter Moleküle. Mehrere Raumsonden haben Kometen direkt erforscht.
4.1 Raumsonde Giotto (ESA)
Die europäische Sonde Giotto flog 1986 am Kern von Halley vorbei und lieferte die ersten direkten Aufnahmen eines Kometenkerns. Sie enthüllte, dass Kometenkerne dunkel, unregelmäßig geformt und mit Eislagen bedeckt sind.
4.2 Deep Impact (NASA)
Für die Mission Deep Impact (NASA, 2005) wurde ein Projektil auf den Kometen Tempel 1 geschossen. Die resultierende Gas- und Staubwolke ermöglichte Analysen über Zusammensetzung und Struktur des Kometenkerns.
4.3 ROSetta & Philae (ESA)
Die bekannteste Mission der letzten Jahre war Rosetta, die den Kometen 67P/Churyumov-Gerasimenko ab 2014 begleitete. Rosetta setzte das Minilabor Philae auf dem Kometen ab, das Bodenproben nahm und das Verhalten des Kometen während seiner Sonnenreise erforschte.
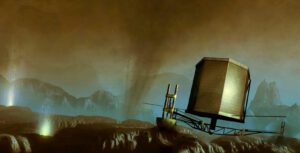
4.4 Stardust (NASA)
Stardust sammelte Staubpartikel aus dem Kometen Wild 2 und brachte sie 2006 zur Erde zurück. So konnte man direkt kosmischen Staub aus der Frühzeit des Sonnensystems analysieren.
4.5 ICE (International Cometary Explorer, NASA/ESA)
Die Sonde ICE war die erste, die einen Kometen (Giacobini-Zinner) direkt passierte. 1985 zeigte sie erstmals, wie Plasma und Magnetfeld eines Kometen mit Sonnenwind reagieren.
5. Kometen beobachten: Tipps für Laien
Kometen zu beobachten ist für Einsteiger faszinierend und einfacher als viele denken. Man braucht keinen Sternwarten-Standort; freie Plätze mit dunklem Himmel reichen oft aus. Besonders in ländlichen Gebieten oder auf Anhöhen ist die Chancen auf eine gelungene Sichtung hoch.
Die wichtigsten Beobachtungstipps
- Vorab informieren: Nutze aktuelle Apps oder schau nach auf astronomischen Website wie dieser
- Freier Horizont: Kometen tauchen oft in geringer Höhe auf. Such dir Standorte mit offener Sicht nach Westen/Norden (je nach Komet).
- Ausrüstung nicht zwingend nötig: Viele Kometen lassen sich mit bloßem Auge sehen. Ferngläser, wie z.B. ein 8×42 oder ein 10×50-Fernglas zeigen im Schweif oft mehr Struktur und Farbe.
- Beobachtungszeiten: Je nach Position des Kometen am besten nach Sonnenuntergang oder vor Sonnenaufgang beobachten, da Kometen oft in der Dämmerung am günstigsten sichtbar sind.
- Geduld und Dokumentation: Schreibe Erfahrungen auf, mache Skizzen oder versuche selbst einfache Fotos – häufig lassen sich Position, Helligkeit und Schweifentwicklung dokumentieren. In der Rückschau sind solche Aufzeichnungen eine tolle Erinnerung.
6. Praxis: Kometen fotografieren – so gelingt es jedem!
Kometenaufnahmen sind ein großartiger Einstieg in die Astrofotografie. Schon Smartphones und einfache Kameras erlauben stimmungsvolle Fotos.
Fototipps für den Einstieg
- Kamera auf Stativ: Ein Muss, egal ob DSLR, Systemkamera oder Handy. So bleibt das Bild garantiert verwacklungsfrei auch bei Langzeitbelichtung.
- Weitwinkel-Objektiv (14–24 mm): Für Landschaft mit Komet und großem Himmelspanorama. Teleobjektive (85–300 mm) für detailliertere Schweifdarstellung. Wenn Du kein Profi bist: Das beste Objektiv ist immer das, was Du hast und auch tatsächlich in den Himmel richtest – im Zweifel einfach mal probieren.
- Manueller Fokus auf unendlich: Kometen sind schwach und weit entfernt, Autofokus funktioniert selten. Im Live-View manuell auf helle Sterne fokussieren. Oder wenn möglich: bei Tag auf weit entfernte Objekte.
- Offene Blende: f/2.8 bis f/5.6, je nach Lichtstärke.
- ISO 1600–3200: Für hohe Lichtempfindlichkeit (eventuell Rauschen nachbearbeiten).
- Belichtungszeit: 2–10 s mit Weitwinkel, 1–3 s mit Teleobjektiv. Kometen bewegen sich schnell, lange Belichtungszeiten können zu Spuren führen.
- RAW-Dateiformat: Für Nachbearbeitung empfohlen, insbesondere wenn das Bild des Kometen mit Stapeln weiterbearbeitet werden soll (also Verstärkung des Bildsignals durch mehrfaches übereinanderlegen des gleichen Bildausschnitts).
- Komposition: Experimentiere mit Vordergrund (Baum, Gebüsch, Berg) für stimmungsvolle Landschaftskometen.

Erweiterte Astrofotografie
- Mit Startracker–Nachführung (motorisiert) lassen sich Kometen punktförmig abbilden, auch bei längeren Brennweiten oder längerer Belichtung.
- Spezialtechniken wie Stacking mit DeepSkyStacker oder Sequator erlauben, mehrere Einzelbilder zu kombinieren und Schweifdetails sichtbar zu machen.
- Apps wie „PhotoPills“, „Stellarium“ oder „SkySafari“ unterstützen bei Standort- und Zeitplanung.
Weiterführende Tipps
Kometen sind Vielschichtige Himmelskörper, die uns Einblicke in die Geburt des Sonnensystems bieten und bei ihrer Reise um die Sonne atemberaubende Lichtshows erzeugen. Egal ob du einfach beobachten, fotografieren oder dich tiefer in die Materie einarbeiten willst – das Wissen über Typen, Missionen, berühmte Himmelsbesucher und praktische Handgriffe bereichert deine astronomischen Nächte.
Für spezielle Fragen, Austausch und weitere Nischen-Tipps empfiehlt sich die Teilnahme an Astronomie-Foren, der Besuch bei lokalen Sternwarten oder Mitmachaktionen auf der Facebook-Seite von Galaxie.digital. Natürlich kannst Du uns auch per E-Mail eine Frage stellen: info@galaxie.digital


